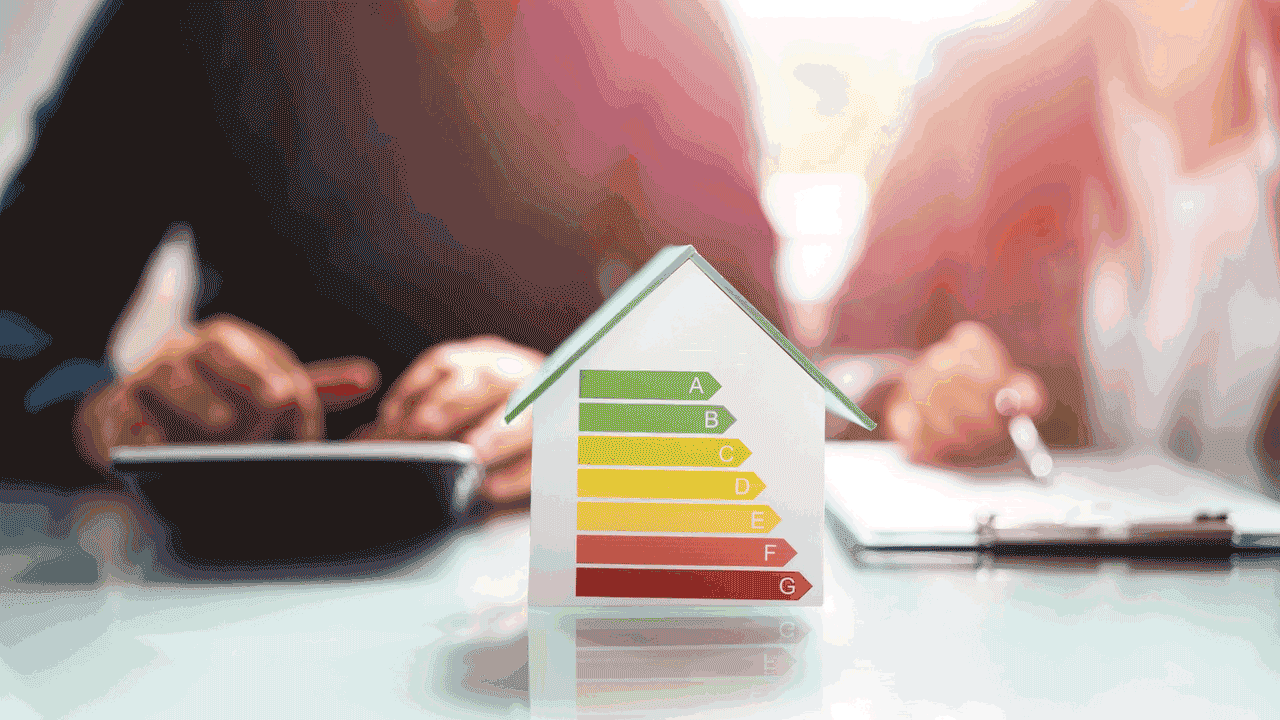Ist der Titel von Lou Reeds Konzertreihe „From VU to Lulu“ als Lockruf oder als Drohung zu verstehen? Die Klassiker von einst neben dem Misserfolg von neulich – ob das gutgeht? Aber die Skepsis ist unbegründet, denn der Altmeister des Rock’n Roll bewältigt die Aufgabe mit Bravour. Nicht nur gelingt die Gratwanderung zwischen den sperrigen neuen Songs und den alten Klassikern, sondern der Ur-New-Yorker zaubert auch noch einige Perlen aus seinem riesigen Backkatalog aus dem Hut.
Lou Reed ist endlich wieder in Deutschland auf Tournee, und zwar mit genau dem Karriere-umspannenden Programm, auf das die Fans seit Ewigkeiten warten. Unter das vielsagende Motto „From VU to Lulu“ stellt Lou Reed seine Tour, und es war sicher, dass er mit seiner Band ein Programm aus dem reichen Schatz seiner Songs zusammenstellen wird mit den Titeln des Ursprungs mit Velvet Underground bis hin zu einigen aktuellen Stücken.
Das einzige ostdeutsche Konzert führte den Meister aus New York am letzten Samstag an das Elbufer zu den berühmten Filmnächten nach Dresden.
Eigentlich mag er Regen. Den der ekligen Sorte: kalt, leicht sprühend. „Sehr gut“, würde er murmeln und dabei aufpassen, auch zu sich selbst nicht unnötig nett zu sein. Das Szenario ist selbstverständlich frei erfunden. Oder besser: die Zwangsvorstellung, die er nach 45 Jahren offen zur Schau getragener mieser Showgeschäft-Laune nun mal haben dürfte. Völlig klar, in Wahrheit ist Lou Reed, der notorische Schwarzkopf und Muffbold des Rock’n’Roll, sicher reizend. Liebt die Fans in aller Welt, streichelt kleine Katzen. Dresden glänzte zudem mit besten Sonnenschein und einem Sonnenuntergang, der es allein wert gewesen wäre nach Elbflorenz zu kommen.
Aber die Feedback-Folter vor Konzertbeginn, die mussten die Besucher am Samstag in Dresden wirklich ertragen. Klänge wie von einer barbarisch gequälten Buckelwalfamilie. „Falls sich da draußen noch irgendjemand gut unterhalten fühlen sollte.“ beschallt er die Leute vor dem Auftritt mit lauter, atonaler Gitarren-Avantgarde-Krachmusik! Der lurchcoole, knirschlederne, heute 70-jährige Straßenpoet Lou Reed hat ja immer ein abstraktes, um Gottes willen kunstsinniges Alter Ego gehabt. Und will, dass sein Publikum das nie vergisst. Selbst wenn es möchte.
Tausende Fans versammelten sich, dort wo am Donnerstag zuvor noch das Trauma der Halbfinalniederlage gegen Italien beim großen Public Viewing verkraftet werden musste. Das abgesperrte Areal hat schon viele Stars gesehen. Lou Reed fehlte da irgend wie noch in der Aufzählung. Und die Lokalität ist perfekt geeignet für Lou Reeds Musik, deren Urbanität aus jeder Note spricht. Aber solche Gedanken hat er sicher nicht, als er mit seiner Band die Bühne betritt, denn er hat eine Agenda.
Lou Reed ist besessen von „Lulu“, seinem grandios gescheiterten Album mit Metallica. Deshalb hat er sich entschlossen, sein Publikum auf dieser Tour ein weiteres Mal mit dem Songmaterial zu konfrontieren, diesmal freilich ohne Metallica. Ohne die Metaller verlieren die Lieder sofort die Aura der unerträglichen Scheußlichkeit und verwandeln sich überwiegend in die unvermeidlichen Lieder vom aktuellen Album eines gestandenen großen Künstlers, die nicht so gut sind wie der Rest, aber auch keinen Fluchtreflex auslösen.
Anders als bei den zurück liegenden Konzerten auf deutschen Boden ist der Opener nicht „Brandenburg Gate“, knallt er nicht weitere Heavy Metal Songs der gefloppten VU Platte über die Elbe. Damit gewinnt das Konzert spürbar. Aber die ebenso laute wie energetische Performance zu Beginn, sorgt für eine rechte Einstimmung auf das, was folgen sollte…
…nämlich mehr epische und krachend laute Interpretationen, diesmal von den Velvet Underground-Klassikern „Heroin“ und „I’m Waiting For The Man“. „Heroin“ gerät aufgrund seiner Tempowechsel, Breaks und Instrumentalparts abwechslungsreich, während „Waiting For The Man“ von Lou Reed mit Sly Stone-Zitaten aus „Everyday People“, „Everybody Is A Star“ und „I Wanna Take You Higher“ angereichert wird.
Diese Momente benutzt Lou Reed, um seine Agenda auf maximale Intensität einzustellen und den epischen Lulu-Rant The View einzustimmen. Wer an dieser Stelle die Gelegenheit nutzt, sich eine überteuerte Bratwurst zu holen oder die Toiletten aufzusuchen, wird feststellen, dass „Mistress Dread“ mit seiner Metal-Inszenierung auch in die hinterste Ecke dringt. Eigentlich unvorstellbar, dass irgendjemand diesen beiden Liedern etwas Positives abgewinnen kann, aber das Publikum jubelt genauso wie bei allen anderen Songs. Die Fans, die den Weg an das Dresdner Elbufer gefunden haben, sind offensichtlich hartgesotten.
Nachdem die Zuschauer zu ihrer offensichtlichen Freude überwiegend mit sehr lauter Musik beschallt wurden, ändert sich später der Charakter des Konzerts. Es dominieren fortan die ruhigen und vergleichsweise melodischen Lieder. Den Anfang macht das wohlvertraute „Street Hassle“ mit seinem charakteristischen Riff. „Think It Over“ ist hingegen eine gelungene Ausgrabung von einem seiner schwächsten nicht experimentellen Alben, nämlich „Growing Up In Public“. Das düstere „Cremation“ stammt hingegen von „Magic & Loss“ einem immer noch weithin unterschätzten Werk.
Die meisten Lieder sind aufgrund der weit nach vorne gemischten Stimme leicht identifizierbar und orientieren sich stark an den Originalversionen, wenngleich „Sad Song“ von der rockigen Inszenierung deutlich profitiert. Lou Reeds Stimme, nie seine stärkste Seite, ist erfreulich gut gealtert und dort wo es notwendig ist, helfen Tony Diodore und eine Backgroundsängerin aus.
Das Tour-Motto „From VU To Lulu“ suggeriert ja auch, dass hier Bilanz gezogen, ein Minimum an Greatest-Hits-Service geleistet werden soll, vielleicht zum letzten Mal. VU steht für Velvet Underground, die Pop-Art-Garagenband, mit der Lou Reed dem Rock’n’Roll Ende der sechziger Jahre die Hippieblumen wegdrosch (und den halben Kopf gleich dazu).
„Lulu“, mehr als 40 Jahre später, sein bislang letztes Werk von 2011, sollte eine große Interpretation der Wedekind-Dramen werden, in Kooperation mit der Heavy-Metal-Gruppe Metallica. Am Ende war es eine hingeschluderte, wenn auch nicht reizlose Kunstübung. Die Hörer der Platte hatten fast nur Spott übrig – für Lou Reed, wie wir ihn kennen, wieder ein Beweis dafür, wie dämlich die Leute sind.
Lou-Reed-Konzerte laufen oft wie dieses Pokerface-Spiel. Und natürlich lacht das Publikum immer zuerst, und selbstverständlich merkt Lou Reed nicht, dass er gewonnen hat, und spielt immer weiter. Eine Stunde, zwei Stunden…
Aber das wird einem tatsächlich erst klar, wenn man das Ganze mal eine Weile ertragen hat, wenn man obskure Stücke wie „Senselessly Cruel“ von 1976 hinter sich hat, ein endlos gehämmertes „I’m Waiting For The Man“ und weitere „Lulu“-Dröhnungen, während es an der Elbe immer dunkler und zum Glück kälter wird. Gleichzeitig ist Lou Reed – so sieht nun mal die Kehrseite der Muffigkeit aus – auch einer der wenigen Künstler, die ihre Zuhörer keine Sekunde lang für dumm verkaufen.
Das bedeutet natürlich auch: In dieser Musik scheinen nicht mal Andeutungen einer Entertainment-Strategie zu stecken. Kein Rausch, obwohl es so oft um Drogen ging, bevor Reed irgendwann die klassische Literatur entdeckte. Dass es durchaus legitim sein kann, dem tanzwilligen Pulk eben keinen Spaß zu machen, ihm von der Bühne herunter nicht mühelose Absolution zu erteilen, ihm ein wenig Arbeit abzufordern, das hat er mit Velvet Underground eingeführt in die Popmusik.
Entgegen seines Images als störrischer Bock, vermag Lou Reed durchaus auch seinem Publikum das zu geben, was es hören will, nämlich die Klassiker „Walk On The Wild Side“, „Beginning To See The Light“ und „Sweet Jane“, das in einer knackigen, konzentrierten Version dargeboten wird. Aber war da noch was? Ach ja, die Agenda! Wenn man „Junior Dad“ von Metallica befreit und das Lied von neunzehn auf fünf Minuten eindampft, wird daraus ein durchaus ordentlicher Song.
Es ist Lou Reed sicherlich nicht gelungen, „Lulu“ zu rehabilitieren, aber sein abwechslungsreicher Auftritt in Dresden bot das, was seine Fans lieben: störrischen Eigensinn, Unbeugsamkeit, Attitüde und Ausdauer. Ebenso wie sein Kollege John Cale ist Lou Reed weit davon entfernt nur die ausgetretenen Pfade entlang zu wandeln. Manche Dinge ändern sich zum Glück eben nie.
Wie viele seiner Rock’n’Roll-Kollegen aus den 40er-Jahrgängen, die derzeit ihre siebzigsten Geburtstage feiern, hatte Lou Reed natürlich ein Vaterproblem. Vielleicht will er ja, ganz tief drinnen, am Ende das für sein Publikum sein: kein cooler Bruder, kein netter Onkel, sondern ein besserer Papa. Und der ist immer auch erziehungsberechtigt.
Ich habe mir die Lehrstunde gern angenommen und dem großen Lou Reed Absolution erteilt.
Text & Fotos: Holger John / VIADATA
[nggallery id=110]