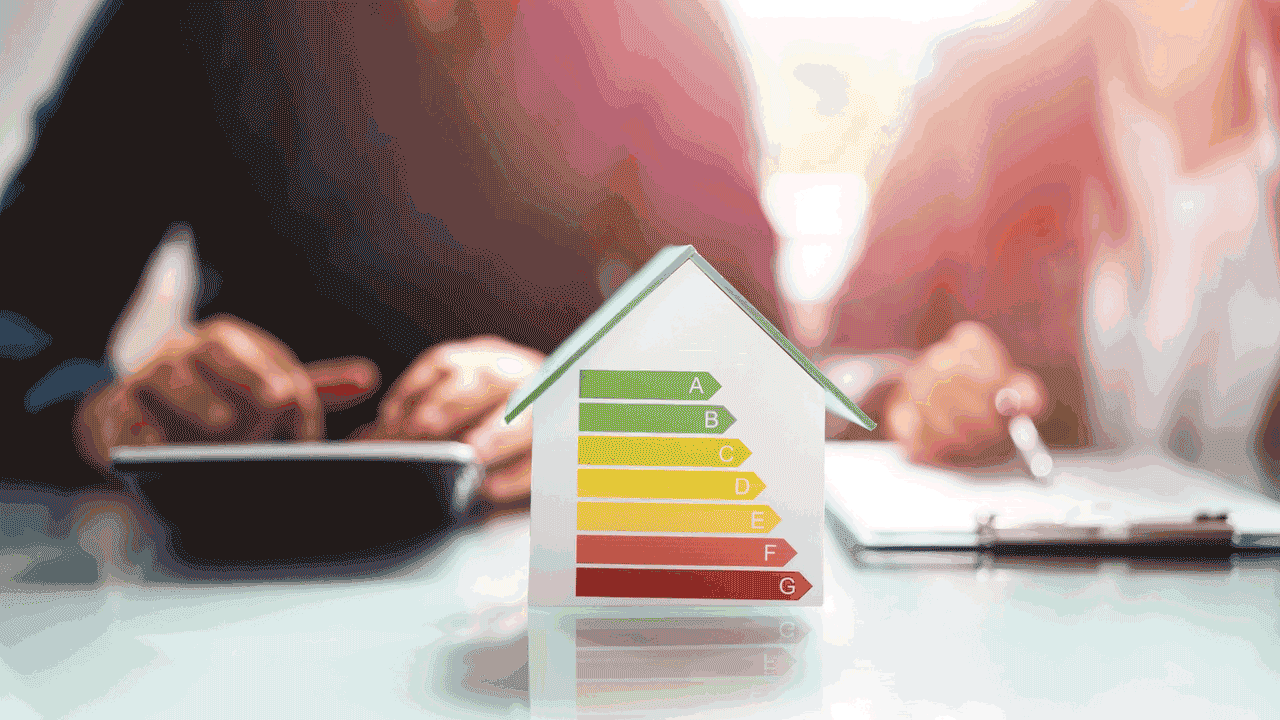Der britische Künstler und Fotograf Steve McQueen hat mit nur zwei Kinofilmen den Ruf eines exzellenten Regisseurs erworben. Seine intensiven, oft drastischen Werke wie „Hunger“ über den Hungerstreik eines gefangenen IRA-Aktivisten und „Shame“, das Porträt eines sexsüchtigen Großstädters, verlangen dem Zuschauer einiges ab. Nun erzählt der 44-jährige die wahre Geschichte des afroamerikanischen US-Bürgers Solomon Northup, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts als freier Familienvater gekidnappt und versklavt wird. Das erschütternde Drama „12 Years A Slave“ gilt als würdiger Oscar-Anwärter. André Wesche traf Steve McQueen in Berlin zum Gespräch.
Mr. McQueen, was gab die Initialzündung zu diesem Film?
Ich wollte einen Film über die Sklaverei machen, aber ich hatte zunächst keine Geschichte und keine Vorstellung, wie er aussehen könnte. Ich benötigte einen sehr starken Beginn und ich dachte an einen freien, schwarzen Mann, der entführt, runter in den Süden geschleppt und versklavt wird. Der Zuschauer folgt ihm und findet heraus, wer dieser Mensch ist. Als ich mit dem Drehbuch auf Schwierigkeiten stieß, riet mir meine Frau, nach wahren Geschichten zu forschen. Sie war es dann auch, die das Buch „12 Years A Slave“ entdeckt hat. Als ich es las, war jede Seite eine Offenbarung. Alles fügte sich perfekt in meine Ideen ein, ich hielt quasi das fertige Drehbuch in meinen Händen. Ich kam mir wie ein Idiot vor, weil ich dieses Buch vorher nicht kannte. Aber dann fand ich heraus, dass es völlig unbekannt war. Ein Grund mehr, einen Film daraus zu machen.
Was wollten Sie zeigen, in welche Richtung wollten Sie sich bewegen?
Das Buch war eine große Inspiration für mich. Seine Sensibilität und seine Detailfreude brachte eine menschliche Seite zum Vorschein, die ich unbedingt in den Film übersetzen wollte. Figuren wie Master Ford sind ungemein komplex. Einen so facettenreichen Charakter habe ich in einer Geschichte wie dieser vorher noch nie gesehen.
Wie kam Brad Pitt als Produzent und Nebendarsteller an Bord?
Brad hat „Hunger“ gesehen und wollte seither einen Film mit mir machen.
Die Stars spielen in Ihrem Film eher die Nebenrollen. War es Ihnen wichtig, dass die Hauptrolle von einem weniger prominenten Schauspieler übernommen wurde?
Natürlich ist Chiwetel Ejiofor weniger bekannt als Brad Pitt oder Michael Fassbender. Was sich jetzt hoffentlich ändern wird. Aber ich denke nicht darüber nach, ob jemand ein Star ist oder nicht, ich denke an große Schauspieler, an Künstler. Das ist es, was sie sind. Chiwetel strahlt Menschlichkeit und Würde aus, Eigenschaften, die auch von Solomon ausgehen sollten, obwohl er sich plötzlich in einer völlig unmenschlichen Umgebung wiederfindet. Der Aspekt, dass die Menschlichkeit auch unter diesen Umständen überleben kann, war von zentraler Bedeutung für mich. Chiwetels charismatische Qualität ist wichtig, damit das Publikum dazu bereit ist, mit ihm auf diese Reise zu gehen, die in schreckliche Gefilde führt.
War es Ihnen auch wichtig, dass die Hauptfigur zunächst ein freier Mann ist, damit sich das Publikum besser mit seinem Verlust der Freiheit identifizieren kann?
Es hätte auch ein Afrikaner sein können, den man aus Afrika nach Amerika gebracht hat. Aber das gab es schon, unter anderem in „Roots“. Mich faszinierte die Tatsache, dass zu dieser Zeit etwa zehn Prozent der Schwarzen frei waren, in den Nordstaaten. Das ist nicht vielen Menschen bekannt. Entführungen waren so lohnend, weil man ab einem bestimmten Zeitpunkt keine neuen Sklaven mehr aus Afrika holte. Das machte das Geschäftsmodell lukrativ, Leute von der Straße wegzufangen. Es ist sehr häufig passiert.
Ihr Film beeindruckt durch großartige Bilder. Welches visuelle Konzept steckt dahinter?
Die Landschaft in Louisiana ist von betörender Schönheit. Es war unser Schlüssel, in Erinnerung zu rufen, dass sich an diesem schönen Ort so schreckliche Dinge abgespielt haben. Unser Film erzählt von wahren Begebenheiten. Deshalb wollten wir das wahre Leben einfangen und es nicht durch einen Filter zeigen. Wir haben das eingefangen, was wir vor Ort vorgefunden haben. Es hat etwas Perverses, wenn ein so schöner Ort zum Schauplatz solcher Grausamkeiten wird. Aber so ist das Leben, es ist extrem pervers. Vorgestern habe ich meinen Sohn zur Schule gebracht. Ich bin dann in meinen Coffeeshop gegangen – tatsächlich trinken wir den Kaffee, wir rauchen ihn nicht (Anm.: McQueen lebt in Amsterdam) – als auf der Straße ein siebenjähriges Mädchen tödlich verletzt wurde. Es war ein so wunderschöner Tag. So ist das Leben. Die Welt dreht sich immer weiter.
Warum interessieren sich derzeit so viele Filmemacher von Spielberg („Lincoln“) bis zu Tarantino („Django Unchained“) für das Thema Sklaverei?
Man darf die Rolle von Präsident Obama nicht unterschätzten. Leute wollten diese Geschichten schon vor langer Zeit erzählen, aber sie konnten es nicht. Heute spüren sie, dass sie die Autorität besitzen, es zu tun. Solche Projekte werden derzeit von verschiedenen Seiten stärker unterstützt, weil wir einen schwarzen Präsidenten haben. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Die Frage ist, was passieren wird, wenn er nicht mehr da ist.
Wird das Buch von Solomon Northup nun wieder herausgebracht?
Das ist bereits geschehen. Es ist sehr erfolgreich und hat es auf die Top-Ten-Liste der New York Times geschafft. Seit vier Wochen hält es sich da.
Was haben Sie über Solomons späteres Leben herausgefunden?
Nicht mehr, als Sie im Abspann lesen können. Der letzte belegte Beweis seiner Existenz war die Nachricht, dass er an einem Theaterstück auf der Basis seines Buches arbeitete. Er hat sich darin selbst gespielt.
Welche Gedanken haben Sie beim Tod von Nelson Mandela bewegt?
Was kann ich sagen? Ich bin jetzt 44 Jahre alt. In diesem Alter war Nelson Mandela, als man ihn in Robben Island eingekerkert hat. Erst mit 71 ist er wieder herausgekommen. Er war ein großer Staatsmann, ein leuchtendes Beispiel für das Beste in uns und als Mensch ein großes Vorbild.
Wenn man den Namen Steve McQueen hört, denkt man zunächst an einen anderen Künstler. Ist das für Sie manchmal seltsam?
Nicht wirklich. Tatsächlich kennen viele Leute den alten Steve McQueen gar nicht mehr. Es ist nur ein Name, den mir meine Mutter gegeben hat.
Die Fragen stellte André Wesche.